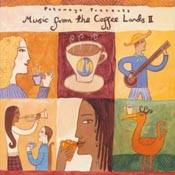 |
"presents:
Music from the Coffee Lands"
Putumayo
Land: Diverse
Label/Vertrieb: Putumayo/Exil
|
Die
kleine Geschichte des Kaffees führt zurück in das achte
nachchristliche Jahrhundert. Der Legende nach soll es ein äthiopischer
Ziegenhirte namens Kaldi gewesen sein, der bei seiner Herde ein
eigentümlich ausgelassenes Verhalten bemerkte, immer wenn die
Tiere die karmesinroten Früchte einer bestimmten Pflanzenart
gefressen hatten. Er beschloss im Selbstversuch, davon ebenfalls zu
probieren und fühlte sich erfrischt, vitalisiert. Beeindruckt
von der Wirkung der kirschengroßen Beeren brachte er ein Säckchen
voll den örtlichen Mönchen, die sie nach eingehender Prüfung
für ein Werk des Teufels hielten und ins Feuer warfen. So
entstanden die ersten gerösteten Kaffeebohnen.
Wie auch immer sich die Ereignisse
zugetragen haben, fest steht, dass sich seit etwa 675 n. Chr.
Kaffeefelder nachweisen lassen, die in der Nähe des Roten
Meeres angelegt wurden. Ihre Früchte blieben zunächst ein
regionales Genussmittel arabischer Volksgruppen, breiteten sich aber
mit zunehmendem internationalen Handel im späten Mittelalter
langsam über Nordafrika aus. Vom 16. Jahrhundert an nahm die
Zahl der Kaffeepflanzungen im jemenitischen Teil Arabiens zu und im
Jahr 1615 schließlich traf die erste Schiffsladung der
sonderbaren Bohnen mit einem türkischen Schiff in Venedig ein.
Es war der Anfang einer abenteuerlichen Entwicklung. Die luxusverwöhnten
Barockhöfe entdeckten das geheimnisvoll exotische Getränk
als Modedroge und importierten es entgegen aller politischen
Ressentiments reichlich von den Arabern und Osmanen.
Der Bedarf stieg stetig und damit auch
die kriminelle Energie. Einem indischen Händler gelang es, ein
paar Kaffeepflanzen um den Bauch gebunden aus dem Anbaugebiet nach
Fernost zu schmuggeln und die Holländer züchteten 1696 als
erste Europäer die begehrten Sträucher in der
indonesischen Kolonie Java. Zum Zeichen der Verbundenheit schenkten
sie 1714 dem französischen Sonnenkönig ein kostbares Pflänzchen,
das seine Hofgärtner sorgsam vermehrten. Neun Jahre später
bereits ließ der französischen Kapitän Gabriel
Mathieu de Clieu auf Martinique Kaffeeplantagen anlegen. Von dort
aus gelangte die Pflanze wenig später nach Südamerika und
veränderte innerhalb von zweieinhalb Jahrhunderten die
wirtschaftliche und gesellschaftliche Infrastruktur großer
Landstriche. Denn der Boden für die Kaffeepflanzen musste
fruchtbar und feucht sein. Er sollte Regen zügig aufnehmen können,
das Wasser aber auch abfließen lassen. Es stellte sich heraus,
dass Brasilien über die nahezu idealen, tropischen
Anbaubedingungen verfügt. Heute wird etwa die Hälfte der
globalen Kaffeeernte über Häfen wie Santos, Rio und Paraná
verschifft. Der Rest stammt aus Kolumbien, Mexiko, Guatemala,
Indien, Indonesien, Vietnam, Äthiopien, Uganda und von der
Elfenbeinküste.
Wegen Kaffee wurden Kriege geführt,
Menschen versklavt und in die Kerker geworfen. Er sorgte aber auch für
angenehme Veränderungen des Alltags. Kaffeehäuser wurden
im bürgerlichen Zeitalter in Europa zu Treffpunkten von Bohême
und Intellektuellen. Kaffeezeremonien gliederten den Tagesablauf in
nordafrikanischen und arabischen Familien. Er wurde zum Inhalt
vorurteilsbelasteter Kinderreime ("C-a-f-f-e-e, trink nicht so
viel Kaffee! / Nicht für Kinder ist der Türkentrank, schwächt
die Nerven macht dich blass und krank / Sei doch kein Muselmann, der
ihn nicht lassen kann!", Kanon von Karl Gottlieb Hering,
1765-1853) und zum kulinarischen Beiwerk nationaler Kulturidentität
(Wien ohne ‚Kleinen Braunen’? Rom ohne Espresso? New York
ohne Coffee Shops?). Er ist nach Wasser das meist konsumierte Getränk
der Welt und kennt keine Grenzen, außer die des übermäßigen
Verzehrs.
Und er stammt aus Ländern, in
denen in der Regel wunderbare Musik gemacht wird. Daher entstand vor
vier Jahren im Hause Putumayo die Idee, einen musikalischen
Streifzug zu entwerfen, der der Klangkultur der Kaffeeländer
Rechnung trägt. Music from the Coffee Lands wurde zum
Publikumsrenner, verkaufte weltweit mehr als 200 000 Exemplare und
legte es nahe, die Reise fortzusetzen. Sie führt auch diesmal
wieder rund um die Welt - von Indonesien (Saba Habas Mustapha &
The Jugala All Stars) über Afrika (Mario Rui Silva, Gigi, Denis
Tshibayi) und die Karibik (Titico Y Los Caracoles Del Amargue,
Emeline Michel, Kali) bis nach Mittelamerika (Correo Aereo) und Südamerika
(Ceumar, Geraldo Azevedo, José Luis Martinez Vesga). Und sie
bietet eine bunte Mischung aus traditionell verwurzelten und modern
geprägten Liedern, die mal verhalten und besonnen, mal
ausgelassen und tanzbar der Spur der Handelsrouten folgen.
- Ceumar (1) zum Beispiel stammt aus der brasilianischen
Provinz Minais Gerais und steht mit klarer Stimme und
transparenten Arrangements für die verhaltenen Seiten der
Musicá Popular Brasileira.
- Mario Rui Silva (2) hat sich der Pflege der Volkslieder
seiner angolanischen Heimat verschrieben, die er mit sensiblem
Gespür für nötige Veränderungen in die
Gegenwart überträgt.
- Gerardo Azevedo (3) kommt aus dem Nordosten Brasiliens und
war bereits in den Siebzigern einer der beliebtesten Sänger
seines Landes, der mühelos zwischen den Ideen João
Gilbertos und der neuen Generation vermitteln konnte.
- Titico (4) wiederum wurde in der Dominikanischen Republik im
Umfeld der Merengue groß, die er jedoch um afrikanisch
ursprüngliche Elemente ergänzte.
- Die Mexikaner von Correo Aereo (5) stellen mit der
Harfenversion eines venezuelanischen Volksliedes eine wunderbar
eingängige Melodie in den Mittelpunkt der Sammlung.
- Sabah Habas Mustapha (6) lässt für seine Jugala All
Stars die herberen Töne seiner Combo 3 Mustapha 3 beiseite
und klingt mit Streel Guitar, Bambus Flöte und
indonesischer Zither wie ein Wanderer zwischen den
Klangkulturen.
- Gigi (7) singt ein äthiopisches Liebeslied
- José Luis Martinez (8) bearbeitet einen
kolumbianischen Song-Klassiker für seine Tiple, eine
Mischung aus nylon- und stahlsaitenbespannter Gitarre.
- Die Sängerin Emeline Michel (9) repräsentiert die
junge, selbstbewusste Popszene Haitis,
- Kali (10) fügt die karibischen Klang- und
Rhythmusimpulse von Jamaika über Kuba bis zu seiner
Heimatinsel Martinique zur individuelle Mixtur zusammen
- und der Kongolese Denis Tshibayi (11) beschließt die
Runde mit einem charmant modifizierten Lovesong.
So ist Music from the Coffee Lands II
nicht nur die Fortsetzung des erfolgreichen Vorgängers, sondern
eine ungewöhnlich eigenständige Bestandsaufnahme globaler
popmusikalischer Kompetenz.
(Pressetext EXIL www.exil.de)
|
|