Ein Bericht von Marianne Berna

Africa-Iwalewa`s Homepage
| Die
Frauen in der Musik Afrika´s Ein Bericht von Marianne Berna |
 Africa-Iwalewa`s Homepage | |
Die Frau
meines Mannes  |
Ein Freund von mir, aus Gabun in
Zentralafrika, hatte die irritierende Gewohnheit, Frauen als »Kleine«
zubezeichnen. Mit Ausnahme von alten Damen oder ausgesprochenen
Respektspersonen nannte er einfach alles Weibliche la petite, wie
stattlich, selbstsicher, reich oder berühmt eine Frau auch sein mochte.
Nachdem mich dieser Tick eine Weile genervt hatte, fragte ich ihn eines Tages: »Warum
sind bei dir eigentlich alle Frauen klein?« Ohne lange nachzudenken
antwortete er: »Weil ich mich dann selbst grösser fühle.« »Die armen Afrikanerinnen stehen doch komplett unter der Fuchtel ihrer Männer!« »Die schwarze Frau schuftet den ganzen Tag, der Mann rührt keinen Finger!« »Polygamie, Klitorisbeschneidung, Zwangsheirat und pausenlose Schwangerschaften - das Leben der Afrikanerin ist von der Wiege bis zur Bahre fremdbestimmt!«  All dies ist wahr. Aber es ist nur ein Teil der Wahrheit. Schaut sie doch an! Die aufrechte Haltung auch der einfachsten Bäuerin, der stolze Gang, die Würde in ihren Zügen, der direkte Blick- sieht so vielleicht eine Sklavin aus? Auch die Musikerinnen machen keineswegs den Eindruck von unterdrückten Wesen oder Sexpüppchen, deren Lebenszweck das Verführen von Männern wäre. Sexy durchaus, sehr oft und ungeheuerlich - aber aus einem eigenen Zentrum heraus, mit einem Selbstbewusstsein, von dem wir nur träumen können. Die Afrikanerin stürzt uns in tiefe Verwirrung. Deshalb versuchen wir, uns wenigstens an Klischees (auch Vorurteile genannt) festzuhalten. Wenn sich unsere Bilder von den Schwarzen als Rasse langsam aufweichen und wenigstens hinterfragt werden, so profitieren davon im wesentlichen die Männer. Die schwarzen Frauen bleiben im Rassenghetto unserer Köpfe gefangen - Opfer nicht nur von Rassismus, sondern auch von Sexismus. Eine fatale Kombination. Denn es gehört ja gerade zu den Eigenheiten von Rassismus wie Sexismus, dass sie sich nicht nur bei den Unterdrückern einnisten - bei den Weissen, bei den Männern -, sondern auch bei den Unterdrückten. Sowenig Schwarze gegen Rassismus gefeit sind, auch wenn er sie zu Opfern macht, sowenig entkommen die Frauen sexistischem Denken. Die schwarze Frau kämpft in einem Vielfrontenkrieg. Dass sie dabei nicht vollkommen untergegangen ist, ist wohl ein Wunder. Aber es gibt auch Gründe dafür. Warum gerade Afrika stärker erdverbunden ist als irgendein anderer Kontinent, weiss ich nicht. Tatsache ist jedoch, dass die Afrikanerinnen und Afrikaner aller Gegenden ihr Land ehrfürchtig und liebevoll »Mutter Afrika« nennen, dass sie der Fruchtbarkeit enormen Wert beimessen, dass sie das Leben als solches über alles schätzen und gemessen. Ein erfrischender Gegensatz zur Todesverachtung der Indianer Amerikas, zum Puritanismus Europas oder zur entrückten Fixierung aufs Jenseits der Araber und Asiaten. Diese Lebenszugewandtheit trägt in sich schon einen Weiblichkeitskult. Nirgends auf der Welt wird die grosse Mutter mehr verehrt; und wenn im christlichen Afrika Jesus doch noch zuoberst im Himmel thront, dann wohl nur deshalb, weil den Af rikanern die Jungfräulichkeit der Maria unnatürlich vorkommt. Sonst hätte sie ihm längst den Rang abgelaufen. Aber Sex gehört für die Schwarzen zum normalen Menschen wie Essen oder Atmen. Sie sehen überhaupt keinen Sinn darin, auf dieses Vergnügen zu verzichten, und einen Jungfräulichkeitskult gab es in Schwarzafrika kaum je. Im Gegenteil: unberührten jungen Frauen empfiehlt man, sexuelle Erfahrungen zu sammeln, und vielerorts heiraten sie erst, wenn sie ein, zwei Kinder geboren haben. Dass Maria vom heiligen Geist befruchtet wurde - das glaubt man in Afrika gern. Aber weshalb sie dazu unbedingt Jungfrau sein musste, sieht kein Mensch ein. Hienieden aber ist es nicht nur ihre Fruchtbarkeit, die den Wert der Frau ausmacht. Ihre Arbeit spielt dabei eine ebensogrosse Rolle. Die Afrikanerin bringt Wasser, schlägt Holz, bebaut das Feld und kocht mit alledem schliesslich auch noch das Essen. Sehr oft verdient sie das Geld. Achtzig Prozent der Arbeit in Afrika werden von Frauen geleistet. Die Gesellschaft ruht auf ihren Schultern, und das weiss sie auch. In der Ablehnung der Polygamie sind wir im Westen uns überall einig. Welche Europäerin würde auch nur daran denken, ihren Mann ganz offiziell mit ein paar weitern Ehefrauen zu teilen? Aber betrachten wir die Sache für einmal von einem andern Standpunkt aus. Dann fällt das Bild vom Hahn im Korb ziemlich zusammen. Denn eigentlich verliert doch der Mann mehrerer Frauen bei ihnen an Wichtigkeit: Es reicht vollauf, ihn ab und zu zu haben (für mehr ist er eh nicht zu gebrauchen). Typisch denn auch, dass in der Vielehe traditionellerweise jede Frau ein Haus hat und der Mann oft keins. Abwechslungsweise geht er zu jeder und ist dabei ewiger Besucher. Auch wenn nominal alles ihm gehören sollte, so hat er in den häuslichen Bereichen grundsätzlich gar nichts zu sagen. Und wenn man weiss, welch zentrale Bedeutung Heim, Herd, Familie in Afrika haben, so beginnt man sich zu fragen, wo denn die Dominanz des Mannes eigentlich bleibt ... Auch über die Kinder hat die Frau die volle Gewalt, zumindest (in islamischen Gesellschaften) bis sie sechsjährig sind. Über die Knaben bestimmt bei den Muselmanen von da an der Vater; die Mädchen jedoch »gehören« ihr, bis sie erwachsen sind. Afrikas Gesellschaften erinnern, genauer betrachtet, häufig an ein Matriarchat. Und wenn davon in der Ethnologie kaum die Rede ist, so sollte man nicht vergessen, dass Ethnologen bis vor kurzem ausschliesslich Männer, europäisch-patriarchal geprägte Männer, waren. Selbst diese voreingenommenen Forscher jedoch mussten in Südafrika des Zulukaisers Shaka weibliche Leibwache und seine »Amazonen«-Regimenter bemerken oder in Ghana feststellen, dass der König bei den Asante eigentlich bloss repräsentierte. Die Entscheidungen fällte stets die Königinmutter, die auch die Linie vererbte. Solch »matrilineare« Vererbungen gibt es weitherum in Afrika. Auch Familiennamen, vom Vater automatisch weitergegeben, existieren eigentlich nur bei den islamischen Völkern. Die andern geben jedem Kind seine ganz eigenen Namen, der vom Vater, der Mutter oder einem Wunschpatron kommen kann, aber nicht muss. Und keine Afrikanerin, islamisch oder nicht, hat beim Heiraten je den Namen des Mannes übernommen. Männerdominanz? |
Mensch oder Sache |
Dass das Patriarchat bei den Schwarzen auf
sehrwackligen Füssen steht, das wissen auch die Männer. Die Anekdote
eingangs dieses Kapitels zeigt das deutlich genug. Doch gerade weil sie so
genau spüren, dass sie fast quantité négligeable sind, wehren
sie sich um so erbitterter. Der Islam, seit dem 12. Jahrhundert in stetem Vormarsch begriffen, die europäische Kolonisation und jetzt die »moderne Zivilisation« lieferten und liefern der Männerherrschaft gar manche Waffe. Sie haben die Frauen entmündigt, ihnen Besitz und Status weggenommen, sie haben sie zum Arbeitstier degradiert und sie in ihrer Not sitzengelassen. Die Königinmutter der Asante ist gestürzt, Shakas Amazonenheer längst besiegt. Aber das endgültige Siegel der Männerherrschaft, das Araber und Europäer - so gut wie Japaner oder Inder - seit Jahrtausender ihren Kulturen aufdrücken, davon hat sich Schwarzafrika bis heute nicht prägen lassen: die Frau zum Objekt zu machen, zum Ding. Dem Feminismus westlicher Art begegnen die Afrikanerinnen deshalb mit Reserve. Sie wissen sehr genau, dass sie entmachtet sind, und von ihrem Widerstand dagegen zeugen ungezählte Frauengruppen oder Initiativen auf jeder Ebene, vom kirchlichen Frauenbund bis zur Gewerkschaft der Stoffverkäuferinnen. Aber sie sagen es immer wieder: Wir kämpfen nicht gegen die Männer, wir kämpfen für uns! |
 |
Die Europäerin muss sich erst mal vom Objekt zum Subjekt emanzipieren, von der Sache zum Menschen. Es ist noch nicht so lange her, da diskutierte unsere Theologie, ob Frauen überhaupt eine Seele besitzen. Dass diese Frage eigentlich noch nicht entschieden ist, zeigt der Gebrauch der Frau zum Beispiel in der Werbung. Notwendigerweise muss sich unser Emanzipationskampf gegen diejenigen richten, die uns zum Objekt machen - die Männer. Für die Afrikanerin wäre das Spiegelfechterei, denn sie war nie Objekt. Wenn die meist von der Kolonialherrschaft übernommenen Verfassungen und Gesetze sie manchmal stark benachteiligen - im Bewusstsein ist sie uns doch einen ganz entscheidenden Schritt voraus. Das sieht man ihr an. |
| Klar, dass dieses Bewusstsein auch ihre Beziehung zum Mann prägt. Ehe oder Liebesbeziehung betrachten Afrikanerinnen mit einer Distanz, die uns hier manchmal krass materialistisch anmutet. Verdient sie Geld, so hat er darauf keinen Anspruch. Auch wenn sie »ihn« von Herzen liebt, sind ihre wichtigsten Ankerpunkte doch immer zuerst ihre eigene Familie, die Kinder, ihre Arbeit, die Freundinnen. - Man fragt sich manchmal wirklich, wozu der Mann denn überhaupt da ist. Sowohl Mimi und Jeanne in Kamerun als auch Nabou im Senegal, deren Männer ich während Wochen kaum je zu Gesicht bekam, antworteten mir, als ich ihnen diese Frage stellte, geradeheraus: um ihnen Kinder zu machen. |
Zur
ersten, zur zweiten, zur dritten...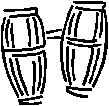 |
Doch hat das afrikanische Patriarchat
der Frau ihre Menschlichkeit nicht nehmen können, so gibt es sich um so
mehr Mühe, sie kurz zu halten. Der Einbruch zivilisatorischer »Errungenschaften«
hilft dabei kräftig mit. In der Stadt zum Beispiel ist es fast unmöglich, jeder Ehefrau eine eigene Wohnung zu geben (ausser sie verdient sie sich selbst, was recht häufig vorkommt). Auf engem Raum wird dann die Polygamie natürlich zum Horror. Noch toller kommt es, wenn Monsieur nach Frankreich zieht, auf Abwechslung aber nicht zu verzichten wünscht. Mein malischer Freund Soumano nahm mich in Paris mal zu einem seiner zahlreichen Verwandten mit. In zwei Zimmerchen lebte der mit zwei Frauen plus zirka fünf Kindern ... Der Herr Gemahl residierte im bessern Zimmer, die Gattinnen kamen des Nachts zu ihm zu Gast und schliefen, wenn die andere dran war, auf dem Sofa. Hätte mir Soumano die Verhältnisse nicht genau erklärt, so hätte ich nie gemerkt, was da gespielt wurde, denn uns Weissen erzählen sie das nicht so schnell. Aber auch wenn ein Mann vernünftig genug ist, nur eine in die Emigration mitzunehmen oder gar nur eine hat, so ist ihr Leben in Frankreich kein Honiglecken. Eheliche Treue zum Beispiel wird in der anonymen Gesellschaft Europas zur totalen Farce. In Afrika sind den Seitensprüngen nämlich zumindest dadurch gewisse Grenzen gesetzt, dass sich eben auch in der Stadt alles kennt. Obendrein findet man kaum eine sturmfreie Bude. Beides ist in Europa kein Problem. Wie die Afrikaner das mit der Treue sehen, illustrierte sehr gut jene Runde von etwa zehn Herren, die einmal in einer kamerunischen Bar am Tisch nebenan tranken und palaverten. Sie waren fröhlich, aber keineswegs betrunken, als plötzlich einer von ihnen stolz ausrief: »Ich habe mir gelobt, meiner Frau eine Woche lang treu zu bleiben!« Seine Kumpane brachen nicht etwa in Gelächter aus, sondern klopften dem Helden staunend auf die Schulter. »Was, hältst du das durch, eine ganze Woche?!« Wen wundert es da, dass die Afrikanerinnen oft extrem eifersüchtig sind und einen Grossteil der Kundschaft bei jedem Dorf- oder Quartierzauberer stellen? Da fast überall die Polygamie gesetzlich erlaubt ist, kann ihr doch plötzlich eine neue co-épouse (Nebenfrau) vor die Nase gesetzt werden eben: die Frau meines Mannes. Eigentlich müsste er die andere(n) ja zumindest konsultieren, ehe er erneut zum Standesamt schreitet, aber in der Praxis verheimlichen sie's manchmal jahrelang. Wenn die Frau Gleiches mit Gleichem vergelten und sich einen Liebhaber nehmen sollte, droht ihr in den islamischen Ländern Rufmord. Das Schlimmste, was man dort von ihr sagen kann: Die weiss selbst nicht, von wem ihre Kinder sind ... Überall habe ich auch immer wieder das Märchen vom Frauenüberschuss gehört - dass es in dem jeweiligen Land auf jeden Mann drei Frauen gebe. Und alle glauben es. So kuschen sie weiterhin; Ja femme soumise, die unterwürfige Frau, gilt bei den Moslems als Ideal. Und doch zeigt gerade die Unterwerfung, dass sie eigentlich ebenbürtig ist. Bei einem Objekt wäre die Sache ja von vornherein klar. |
 |
| In jenen Teilen Afrikas, wo der Islam
(bisher) nicht hinkam, steht es ein bisschen besser. Zaire, Kongo, Gabun,
Kamerun sowie Teile von Benin, Togo, Burkina Faso und der Elfenbeinküste
sind christlich oder animistisch (mit fliessenden Übergängen) und ganz
eindeutig frauenfreundlicher. Ledige Mütter zum Beispiel gibt es in jeder
Familie, und wenn es als eher indiskret gilt, sich nach den Vätern der
einzelnen Kinder zu erkundigen, so sind solch erratische Stammbäume noch
lange kein Grund für einen schlechten Ruf. Eines Tages zum Beispiel kam
die vierzehnjährige Tochter eines hochgestellten Pastors, des Oberhirten
einer ganzen evangelischen Provinz, schwanger heim. Wenn ihre Mama, ebenfalls
hohe Funktionärin der Kirche, den Enkel kurzerhand als Sohn adoptierte, so
wahrt sie diesen Schein vor allem gegenüber den Weissen von der Mission,
mit denen sie häufig zu tun hat. Die Einheimischen wissen ganz genau, wer
da wessen Kind ist, finden das Arrangement jedoch völlig normal. Denn
schliesslich soll die Teenage-Mutter ihre Schule abschliessen, wenn schon genügend
Geld dafür da ist. Dass Herzensbindungen nur selten dauern, weiss jede Frau, drum sieht sie sich beizeiten nach Trost um, wenn der Mann zu viel Zeit mit seinem deuxiöme und troisiäme bureau, seinem zweiten und dritten Büro, und der roue de secours, dem Ersatzreifen, verbringt. (Diese Ausdrücke stammen ursprünglich aus Zaire, sind inzwischen aber überall gebräuchlich. Selbst die Mätressen unterstehen in Afrika einer Rangordnung ...). Auch in Frankreich fallen die Afrikanerinnen aus den nicht-islamischen Gegenden durch mehr Selbstbewusstsein auf. Bessere Schulbildung und weniger Unterwerfung erlauben ihnen, sich viel freier zu bewegen. Meist arbeiten sie ausser Haus und verfügen so auch über eigenes Geld, wenn sie nicht von vornherein ohne Mann gekommen sind und eh für sich selbst sorgen. Auch sie haben in Europa gegen Sexismus und Rassismus zu kämpfen. Aber sie haben bessere Chancen. |
Afrikanerin
in Europa |
Viel schlimmer sieht es für die
Muselmaninnen aus, und islamisch ist ein grosser Teil des frankophonen Afrika.
In Senegal, Mali, Guinea, Tschad und Niger regiert de facto der Koran; auch
Gebiete von Burkina Faso, Benin, Togo, der Elfenbeinküste und Kamerun sind
islamisch. Und wenn sich der schwarzafrikanische Islam nicht mit dem arabischen
vergleichen lässt, wenn die alten Götter und das Matriarchat auch nur
gerade knapp überdeckt wurden, so hat es doch ausgereicht, die Frau eben zu
unterwerfen. Schulbildung wäre dem nur abträglich wie überhauptjede Fertigkeit, die sie selbständiger machen könnte. Die Afrikanerinnen kämpfen zwar wie Löwinnen gegen all diese Handicaps, denn sie wissen genau, dass sie ohne ihre Tatkraft noch schneller in das Elend abtauchen würden, in dem der Kontinent gegenwärtig ertrinkt. Aber sie haben die Welt gegen sich. In Europa drohen sie dann schnell unter die Räder zu geraten. Bei dem Durcheinander sich auflösender Geschlechterrollen finden ja nicht mal wir selbst uns noch zurecht. Da knallt plötzlich harter Sex von jeder Plakatwand oder Bilder aus der Glotze, die in Afrika undenkbar wären. Oft sprechen sie kein Französisch, das isoliert sie total. So verkriechen sie sich dann in ihrer Wohnung. Dort versuchen sie, um den Preis ihres Überlebens, das Reich wiederherzustellen, das ihr Haus in Afrika immer war, und das gelingt ihnen oft erstaunlich gut. Die Tragödie ist nur, dass dies hier nicht genügt. Europa verlangt auch von ihnen viel Organisation: die Kinder in der Schule, Ferien einfädeln Sozialamt, Zahnarzt und Impfungen, dann der Einkauf im Supermarkt, die Metro (nur schon diese Billettautomaten!), der Umgang mit Elektrisch, Gas, Heizung, Waschmaschinen und all die Kleider, die es hier braucht... Das Leben hier ist unsäglich kompliziert. Dass sie nicht alle medikamentensüchtig sind oder in der Klapsmühle landen, zeigt, wieviel Kraft die Afrikanerinnen haben. |
Alles
leichte Mädchen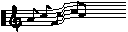  |
Am Jazzfestival Montreux spielten vor
ein paar Jahren
King
Sunny Ade und seine Riesenband aus Nigeria. Die in der Schweiz
lebenden Nigerianer erklärten den Abend selbstverständlich zum
Galaanlass und reisten von weither an, um dem Star der
Jujumusik
in seiner Sternstunde an diesem renommierten Festival die Ehre zu erweisen.
Auch die gesamte Diplomatie von der Botschaft war da, alles hatte sich in die
schönsten Boubous gestürzt. In der Musikerbar nach dem Konzert kam
man sich wirklich vor wie an einem afrikanischen Königshof (obwohl »King«
Sunny Ade´s Adel rein musikalischer Natur ist - er stammt nämlich aus
einer Pfarrersfamilie und hat soviel blaues Blut wie King Elvis Presley). Die
Party schlug hohe Wellen, wenn auch die Stimmung merkwürdig gedämpft
blieb. Plötzlich gab es einen Aufruhr in der Bar. Einer dieser hochgewachsenen Herren in weissem Boubou schlug in blinder Wut auf eine schwarze Frau ein, die unter seinen Schlägen zu Boden ging. Er traktierte sie mit Fusstritten ins Gesicht und knallharten Boxhieben, ehe noch die Umstehenden eingreifen konnten. Schliesslich entfernte man den Gewalttätigen, sein Opfer verschwand ebenfalls, gestützt von zwei Freundinnen. Es dauerte etwa eine halbe Stunde, bis ich meine weichen Knie soweit unter Kontrolle hatte, dass ich auf die Toilette gehen konnte. Dort, in einer Schminknische, kauerte die geschlagene Frau, einem Nervenzusammenbruch erlegen. Während ihre Freundinnen, selbst um Fassung ringend, versuchten, ihre Platzwunde an der Stirn zu verbinden und sie zu beruhigen, schrie sie bruchstückweise ihr Elend heraus. Mit den Ergänzungen ihrer Begleiterinnen ergab sich daraus folgende Geschichte: Die drei schwarzen Frauen waren Lehrerinnen in New York. Nach vielen Jahren des Sparens konnten sie sich endlich ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen: eine Europareise. Höhepunkt des Trips sollte das berühmte Jazzfestival Montreux sein, und am meisten freuten sich die Frauen auf den Abend mit den afrikanischen »Brüdern«, die ja für die schwarzen Amerikaner die ganze Sehnsucht nach der verlorenen Heimat verkörpern. Nach dem Konzert schafften es die drei New Yorkerinnen, sich in die Musikerbar hineinzuschmuggeln. Sie suhlten sich in dem afrikanischen »Feeling« und liessen sich gern auf einen Flirt ein. Der Lange im Boubou war auch ein Muster an Charme, bis er unsere Lehrerin fragte, was sie denn so treibe im Leben. Als sie ihre Schule in Brooklyn erwähnte, lachte er nur und höhnte: »Ach, erzähl mir keine Märchen, ihr seid doch alle leichte Mädchen!« Die Lehrerin war nicht nur rassenbewusst, sondern hatte auch fünfzehn Jahre amerikanischen Feminismus in sich. Sie reagierte, wie jede temperamentvolle Frau reagiert hätte: mit einer schallenden Ohrfeige. Worauf der Bouboumann ausrastete und sie zusammenschlug. Dabei hatte er die Lehrerin vielleicht nur ein wenig necken wollen. Denn möglicherweise verstand er das »leichte Mädchen« gar nicht als schwere Beleidigung in unserem Sinn. Das hängt davon ab, wie sehr er europäische Moral schon verinnerlicht hat. Seine Gewaltexplosion lässt jedenfalls darauf schliessen, dass er noch sehr afrikanisch dachte: Sich von einer Frau schlagen zu lassen - und dann noch in der Öffentlichkeit-, das kann sich kein Afrikaner gefallen lassen. Wenn sie ihn zurechtweisen will, so gibt es dafür andere Mittel. Die Lehrerin ihrerseits empfand den Verdacht der Prostitution als äusserste Beleidigung. Wie hätte sie verstehen sollen, dass in grossen Teilen Afrikas das Verkaufen der körperlichen Liebe vielleicht nicht gerade sehr ehrenvoll ist, aber niemals derart ausgegrenzt wie bei uns? Materielle Interessen spielen nämlich in Beziehungen zwischen Mann und Frau eine weit stärkere Rolle als im Westen. Die meisten Afrikanerinnen erwarten von einem Mann Geschenke und Geld, ohne deshalb auch nur auf die Idee zu kommen, sie würden sich prostituieren. Sich einladen lassen, sich aushalten lassen, als deuxième bureau oder als Ehefrau - wo wären da die Grenzen zu ziehen? Im übrigen gilt die »lockere Moral« auch umgekehrt: Meine französische Freundin Brigitte hat seit einem Jahr einen Liebhaber, derweit jünger ist als sie. Thomas ist der Thronerbe eines Königshauses in Togo und bereitet sich an der Uni in Paris auf seine Regierungsaufgaben vor. Eines Abends brachte ich die beiden mit einem Landsmann von Thomas zusammen, den sie nicht kannten. Die Männer unterhielten sich sehr angeregt miteinander, der Abend war charmant, doch nächstentags rief mich Brigitte empört an. Mein Bekannter hafte Thomas gefragt, ob er sich von Brigitte aushalten lasse! Sie war völlig aufgelöst über die Unverschämtheit, so etwas nicht nur zu denken, sondern auch noch ganz offen zu fragen. Thomas dagegen blieb ganz gelassen und sah gar nicht recht ein, worüber sich Brigitte so aufregte. Einen jungen Liebhaber auszuhalten ist bei den Christen und den Animisten -jedenfalls im ursprünglichen afrikanischen Verständnis - auch für eine Frau in keiner Weise ehrenrührig. Europäische Ideen über die Stellung von Mann und Frau aber haben, mit der Kolonisation und mehr noch mit der wirtschaftlichen Beherrschung Afrikas, auch dort streckenweise Einzug gehalten, besonders in der »assimiliertenc« Oberschicht, die ja oft im Westen ausgebildet wurde und wird. Wo hingegen die Frau nach altem Brauch Mensch geblieben ist, kann auch differenziert werden. Selbst wenn sie tatsächlich auf der Strasse Freier anmacht, fällt sie deswegen nicht aus der Gesellschaft raus. Femme libre, »freie Frau«, ist also nicht einfach ein netter Euphemismus für die Hure, sondern bezeichnet recht genau den Status der »Prostitution« in Afrika.  Im Zuge der Assimilation, der kulturellen Anpassung an den Westen, geraten natürlich auch die Geschlechterrollen in den Fleischwolf. Viele Afrikanerinnen möchten »moderne« sein und versuchen, sich so zu verhalten wie die Frauen im Westen - nach den Vorbildern, die sie am Fernsehen in »Dallas« sehen ... Ein echter Kuhhandel: Nicht nur verlieren sie jeden Respekt der Männer, die sofort spüren, wenn sich eine Frau aufgegeben hat, sondern obendrein werden sievon den»traditionellen« Frauen als Verräterinnen gebrandmarkt. In Afrika setzen ihnen die meistens ziemlich bald den Kopf zurecht. Aber in Europa können sie sehr schnell sehr tief sinken. Dann sind sie wirklich nur noch arme Huren - von »freier Frau« keine Rede mehr! |
Musikerinnen
- nur regional vorhanden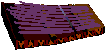 |
Femme libre zu sein ist eins,
aber auf einer Bühne zu stehen - das wird dann doch sehr schwierig. Wo das
»Lotterleben« der Musiker gerade gut genug ist für die
Griotkaste, da haben es Frauen doppelt schwer. Musikerinnen sind darum, auf
diesem musikalischsten aller Kontinente, immer noch mit der Lupe zu suchen.
Zwar lassen sich Fortschritte ausmachen, aber mit Ausnahme einiger weniger
Gegenden ringen die Frauen noch überall um das Mikrofon. In Südafrika waren die Frauen anscheinend von alters her dem Mannsvolk ebenbürtig. Schon Shakas Soldatinnen waren keine Memmen, und unter dem Apartheid-Regime bleibt den Frauen gar nichts anderes übrig, als den Karren allein zu ziehen, wenn ihre Männer jahrelang in irgendeinem Arbeitscamp schuften. In der starken Tradition des Chorgesangs, die die Musik Südafrikas auszeichnet, spielten die Frauen denn auch stets eine tragende Rolle. Wie hätte man auf diese kraftvollen Stimmen verzichten mögen? Es ist darum kein Zufall, dass die Ahnherrin aller afrikanischen Musikerinnen und eine der wichtigsten Vorläuferinnen dieser Musik überhaupt aus Südafrika stammt. Miriam Makebas Talent war so enorm, ihr Wille so stark, dass weder das Zwangsexil, zu dem sie seit 1961 verurteilt war, noch irgendein anderer Schicksalsschlag sie bremsen konnte. Mit der Öffnung des Westens den afrikanischen Sounds gegenüber erschliesst sich auch der Reichtum Südafrikas an anderen Musikerinnen. So gelang zum Beispiel den Mahotella Queens, den drei Bandkolleginnen von West Nkosi, nach zehnjähriger »Kinderpause« 1986 schliesslich sogar der Durchbruch in Europa, wo sie seither regelmässig auftreten. Sie beeindrucken das weisse Publikum nicht nur mit ihren umwerfenden Tänzen, ihrer Beweglichkeit und Energie, die sie nebst herrlichen Stimmen zu bieten haben. Ganz verdutzt sind die Weissen auch immer von der Selbstverständlichkeit, mit der die Mahotella Queens die Speckröllchen der reifen Frau zeigen, dem Verzicht auf »jugendliche« Tünche und ähnliche Tricks. Das Trio Shikisha, die Sängerin Brenda Fassie oder die 1986 verstorbene Bongi Makeba, Miriams Tochter, gehörten zur jungen Garde, die die Tradition des südafrikanischen Frauengesangs im besten Sinne weitertragen. Etwas weiter nördlich, in Zimbabwe, ist Stella Chiweshe zu Hause. In jungen Jahren, erzählt Chiweshe, haben ihr die Geister der Ahnen befohlen, das Spiel der Mbira, des Fingerklaviers, zu erlernen, in dem ein Onkel von ihr bereits Meister war. Sie wehrte sich gegen den Auftrag, weil es in ganz Zimbabwe keine einzige Frau gab, die Mbira spielte. Als die Ahnen ihr keine Ruhe liessen, kämpfte sie sich schliesslich durch alle familiären Widerstände und wurde mit einem Seelenfrieden, einer innern Harmonie belohnt, die sie auch von der Bühne ausstrahlt. Ihre »weibliche« Weiterentwicklung der Mbira-Tradition hat Weltklasse. Aber diese »Hexenmusik« verlangt genaues Hinhören, und zum Popstar wird die Magierin der Mbira nie werden. Warum die Zairerinnen schneller ans Mikrofon gelassen werden als andere Afrikanerinnen, muss Gegenstand zukünftiger Forschung bleiben. Vielleicht liegt es daran, dass selbst die zairischen Männer so feminin klingen, mit ihren hohen Stimmen und den Herz-Schmerz-Songs? Auf jeden Fall stellten sich zairische Frauen schon in den siebziger Jahren auf die Bühne und reisten, wie ihre männlichen Kollegen, nach Brüssel und Paris ins Plattenstudio. Und blieben. Abéti Masikini, die erste, die zu Ruhm kam, lebte eine Weile in Kamerun, dann in der Elfenbeinküste und schliesslich lange in Paris, ehe sie sich wieder in der Heimat niederliess. Tshala Muana, ihre »Schülerin«, zog ebenfalls nach Abidjan und Paris. Die Zeit in der Fremde scheint ihr aber nur gut getan zu haben. Statt wie Mbilia Bel oder deren Nachfolgerin Faya Tess ihr Talent in seichten Liebesliedchen im ewigen Soukous-Stil zu ersäufen, lässt Tshala vergessene Folklore wiederaufleben und überrascht uns immer wieder mit guten Eigenkompositionen. Aber selbst Mbilia Bel, als Stereotyp des schönen Dummchens mit Honigstimme verkauft, schnuppert jetzt Morgenluft! Jahrelang war sie mit Tabu Ley Rochereau liiert, beruflich wie privat, der sie vom Chorgirl zum Superstar machte. Sie liess sich manches gefallen, bis Rochereau 1987 dem Fass den Boden ausschlug: Setzte er doch auf dem Album mit dem bezeichnenden Titel »Contre ma volonté« (Gegen meinen Willen«) unter die Photos des Künstlerpaares die Worte une voix et un cerveau: »eine Stimme und ein Hirn«! Dass Rochereaus einst brillante Karriere an Schwindsucht leidet, dass er sich seit langem nur dank Mbilias Goldkehle über Wasser halten konnte, war allen klar. Sich aber als hirnlose Stimme hingestellt zu sehen, fand Mbilia denn doch zu bunt. Sie kündigte ihm Ehe wie Bühne und emigrierte nach Frankreich. Hier gab sie zwei Jahre später ihr erstes Soloalbum »Phénomène« heraus. Darauf sind - nebst den unumgänglichen Tanzhits - auch zwei Songs in ganz neuem Stil, die Mbilias wahre Dimension endlich zeigen. Im übrigen frankophonen Afrika sind Musikerinnen noch Einzelfälle. Selbst in Kamerun, dem musikalisch wohl fortgeschrittensten Land des Kontinents, treten sie eben erst aus dem Schatten der Männer. Charlotte Mbango und Grace Decca, die Schwester des Topstars Ben Decca, verdienten sich jahrelang ihre Sporen als Choristinnen ab, ehe sie endlich zu Soloalben kamen - die in beiden Fällen zu grossen Hits wurden. Auch an der Westküste fassen Frauen Mut. Zu den grössten Hoffnungen Anlass gibt die Beninerin Angélique Kidjo, ein Ausbund von Charme und Talent. In Paris ansässig, schaffte sie sich international einen Namen als Sängerin bei Jasper Van't Hofs Jazzgruppe Pili Pili und hat seit 1990, als sie ihr erstes, sehr vielversprechendes Soloalbum abgeliefert hatte, bereits 3 weitere CDs produziert. An der Elfenbeinküste dagegen sind die paar bekannten Sängerinnen musikalisch entweder ziemlich einfallslos geblieben, wie Aicha Kone, oder haben sich seichtem US-Pop verschrieben, wie Nyanka Bell. Von der charaktervollsten Stimme dieses Landes, Reine Pélagie, hat man seit Jahren nichts mehr gehört. |
Im
Zweifelsfall den Boubou |
Klar, dass die Situation in den
islamischen Gebieten für die Frauen am schlechtesten aussieht. Kann die
traditionelle Musik, der Griot-Gesang, auf sie auch nicht verzichten - unter
Popstars hat eine anständige Muselmanin deshalb noch lange nichts zu
suchen. Den Bruch mit der Tradition nimmt man den Frauen eben immer noch sehr übel.
Im übrigen eignen sich ihre Stimmen auch nur bedingt für moderne
Musik: Sie klingen nämlich in der Regel ziemlich gepresst, »quäkig«
- unterwürfig sozusagen. Die Malierin Nahawa
Doumbia oder
Kine
Lam aus dem Senegal haben diese schrillen Vocals mit elektrischem
Sound auch in Europa bekannt gemacht, aber für meine Ohren müssen sich
diese Frauen erst noch richtig freisingen. Dann allerdings können wir uns
auf Grosses gefasst machen. Die jüngste Generation deutet schon an, was in
den Muselmaninnen auch noch steckt.
Djanka
Diabaté, wie
Oumou
Sangare aus Mali, hat noch nicht ganz die Stimmgewalt von
Landsleuten wie
Salif
Keita oder Kasse Macly, aber sie sind auf dem besten Weg dazu.
Noch einen Schritt weitergegangen ist Aminata Fall. Statt als Chorgirl Hintergrund zu dekorieren, hat sich die Senegalesin gleich ans Piano gesetzt und kreiert völlig Neues: »Mbalax-Jazz« möchte ich ihre Mixtur von Carla Bley und Senegal-Pop nennen. Aminata Fall und Stella Chiweshe sind bislang fast die einzigen Instrumentalistinnen auf dem afrikanischen Kontinent; richtige Frauenbands gibt es -von Zap Mama abgesehen, und die kommen aus Belgien- nur eine. Die Amazones de Guinée verdanken ihre Existenz dem Regime Sekou Tourés, der Guinea 25 Jahre lang mit eisern-sozialistischer Hand regierte. Zu seinem Programm gehörte eine massive Kulturförderung - und die Emanzipation der Frauen. So gelangte die Populärmusik Guineas zu grosser Blüte, und wenn das Frauenorchester der Verkehrspolizei auch lange eine Alibifunktion hatte, so erlaubten Übungsdisziplin und Monatslohn im Verlauf der dreissig Jahre ihrer Existenz doch einigen Dutzend Amazonen profimässiges Musikerinnendasein. |
 Auf europäischen Bühnen sieht man sie nicht allzu
oft, die afrikanischen Musikerinnen. Auch wenn sie häufig in Paris weilen,
z.T. sogar da leben, treten sie lieber nur an afrikanischen soirées oder
in Boites auf. Sie haben den Braten wohl gerochen und begegnen unserer
Popstar-Wirtschaft mit äusserstem Misstrauen. Recht haben sie. Statt
sich, wie viele ihrer »Schwestern« von den Antillen, verkaufsfördernd
zur Sexpuppe stylen zu lassen, bleiben sie lieber unter sich, bis sie sich stark
genug fühlen, um solchen Zwängen zu widersten. Den Südafrikanerinnen
ist das, wie es scheint, von Gott gegeben, die Zairerinnen sind schon sehr
vorsichtig, und die Muselmaninnen treten - ausser zum Tanzen - am liebsten im
Boubou auf eine Bühne. So umschiffen sie das Problem. Auf europäischen Bühnen sieht man sie nicht allzu
oft, die afrikanischen Musikerinnen. Auch wenn sie häufig in Paris weilen,
z.T. sogar da leben, treten sie lieber nur an afrikanischen soirées oder
in Boites auf. Sie haben den Braten wohl gerochen und begegnen unserer
Popstar-Wirtschaft mit äusserstem Misstrauen. Recht haben sie. Statt
sich, wie viele ihrer »Schwestern« von den Antillen, verkaufsfördernd
zur Sexpuppe stylen zu lassen, bleiben sie lieber unter sich, bis sie sich stark
genug fühlen, um solchen Zwängen zu widersten. Den Südafrikanerinnen
ist das, wie es scheint, von Gott gegeben, die Zairerinnen sind schon sehr
vorsichtig, und die Muselmaninnen treten - ausser zum Tanzen - am liebsten im
Boubou auf eine Bühne. So umschiffen sie das Problem.Rasante Entwicklungen sind vorauszusehen. Die Geschlechterproblematik ist auch in Afrika aufgebrochen und wird sich natürlich weiterhin in der Musik spiegeln. Und wenn die Afrikanerinnen unsere Gebräuche auch weit kritischer beäugen als ihre Männer, so zieht es sie doch in unsere Gefilde, auf unsere Bühnen. Liebesgeschichten sind programmiert ... |
|
aus dem Buch " Paris wie die Wilden " Afrika - seine Musik - ihre Metropole von Marianne Berna und Bill Akwa Betote erschienen im ECO-Verlag ISBN 3-85647-105-7 Der ECO-Verlag stellte uns freundlicherweise dieses Material zur Verfügung. Fotos Courtesy by ECO-Verlag, Zürich |
| webmaster schoenenberg@edina.xnc.com | ||
| Eine Produktion für | Copyright bei | mit Unterstützung der |
 |
 |
 |